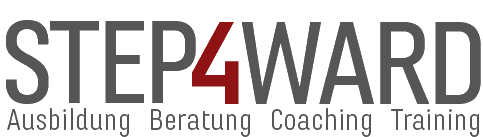Motivationspsychologie
Change im denken und handeln im Bereich Motivation, um Change Prozesse erfolgreich umzusetzen!
Was sind Motive und weshalb sind intrinsische Motive für unsere Motivation so wichtig?
Motive sind richtungsgebende, leitende und antreibende psychische Ursachen menschlichen Handelns.Edelmann (1986) bezeichnet das Motiv als Persönlichkeitsdisposition und den Aufforderungscharakter als emotionale Valenz des Zieles. Heckhausen (1980) weist darauf hin, dass sich Motive im Laufe einer individuellen Lebensgeschichte als relativ überdauernde Wertungsdisposition herausgebildet haben. „Motive stehen hier als Sammelname für unterschiedliche Bezeichnungen wie Bedürfnis, Beweggrund, Trieb, Neigung und Streben.
Bei allen Bedeutungsunterschieden im Einzelnen verweisen alle die Bezeichnungen auf eine dynamische Richtungskomponente. Es wird eine Gerichtetheit auf gewisse, wenn auch recht unterschiedliche, aber stets wertgeladene Zielzustände angedeutet; und zwar Zielzustände, die noch nicht erreicht sind, deren Erreichung aber angestrebt wird.
Motive sind also Persönlichkeitsdispositionen. Bereits Edelmann und Heckhausen stellen fest, dass Motive „beträchtliche individuelle Unterschiede aufweisen“.
Unsere Motive sind so verschieden, wie Personen in ihrer Persönlichkeit verschieden sind. Dass was bei allen Menschen gemeinsam anzutreffen ist und uns verbindet, ist das „Streben nach positiven Erlebniszuständen und das Vermeiden negativer Erlebniszustände“. (G.Roth, 2007, S.251)
Wir gehen seit einigen Jahren von 16 unterschiedlichen intrinsischen Motiven aus, die in sich eine individuelle Ausprägung aufweisen, aus.
Motive richten, ohne dass dies bewusst werden müsste, das Verhalten auf bestimmte Ziele aus. Motive sind keine Kompetenzen, doch sehr häufig der Grund für Kompetenzerwerb und -einsatz. Motive sind verantwortlich für die Handlungssteuerung und -energetisierung und sorgen für eine zielbezogene selektive Informationsverarbeitung.
Motive stellen von Fähigkeiten und Persönlichkeitsstilen deutlich abgrenzbare Dispositionen der Selbstorganisation dar. Fähigkeiten (z.B. Intelligenz) und Persönlichkeitsstile (z.B. Extraversion) erklären das Wie? des Verhaltens, während Motive das Warum? erklären helfen.
Langens, Th; Sokolowski, K.; Schmalt, H-D. (2003) differenzieren zwischen impliziten und explizitenMotiven. Implizite Motive sind tief im affektiven Bereich verankert und werden automatisch aktiviert. Explizite Motive werden dagegen durch bewusste kognitive Vorgänge, wie z.B. Vornahmen oder Ziele aktiviert und sie spiegeln Aspekte des Selbstkonzeptes der Person wieder
- Roth (2007, S. 249) unterscheidet zwischen biogenen und soziogenen Motiven. Sie schließen sich in ihrer Ausprägung nicht aus. Damit es zur Wirksamkeit aller soziogenen Motive kommen kann, müssen sie vielmehr mit den biogenen Motiven verbunden sein. Das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass die durch das intrinsische Motivations-Profile ermittelten 16 Motive in ihrer individuellen Ausprägung für sich alleine bereits eine hohe Aussagekraft besitzen, die Wirksamkeit für die Gesamtpersönlichkeit sich jedoch aus dem Zusammenwirken aller Motive ergibt.
Wie die Motivation unser Erleben und Verhalten bestimmt?
Motivation geht auf den lateinischen Begriff movere (= bewegen) zurück. Er gibt Aufschluss über die Beweggründe des Handelns und Verhaltens eines Menschen.
Einzuordnen ist der Begriff der Motivation in die Motivationspsychologie. Die Psychologie befasst sich mit dem Erleben und Verhalten des Menschen.
Die Motivationspsychologie befasst sich damit, Richtung, Ausdauer und Intensität des Erlebens und Verhaltens zu erklären. Charakteristisch dafür ist, dass angestrebte Zielzustände und das, was sie attraktiv macht, die zu erklärenden Größen sind. Die Aufgabe der Motivationspsychologie ist es, die verschiedenen Komponenten und Teilprozesse in ihrem Zusammenspiel zu beschreiben und zu erfassen, ihre Abhängigkeiten und Varianten der Beeinflussungen zu bestimmen und ihre Auswirkungen im Erleben und Verhalten näher aufzuklären.
Der Motivationsbegriff beschäftigt sich mit den verschiedenen Prozessen des Lebensvollzuges, die mit den der ausdauernden Zielausrichtung unseres Verhaltens zu tun haben.
Unter Motivation wird der Drang zur Aktivität verstanden und das unabhängig davon, ob sie nun nützlich ist oder nicht. Motivation hat also keine positive Konnotation, sondern ist zunächst einmal neutral.
Die Motivation bestimmt über die Richtung, die Intensität und die Dauer unseres Handelns.
Rheinberg (2000) beschreibt Motivation als eine „aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzuges auf einen positiv bewertenden Zielzustand. An dieser Ausrichtung sind unterschiedliche Prozesse im Verhalten und Erleben beteiligt, die in ihrem Zusammenwirken und ihrer Beeinflussung näher aufgeklärt werden sollen.
Hunt und Heckhausen (1989) benutzen zwei unterschiedliche Bezeichnungen für die Motivierung beim Lernen:
- Die intrinsische Motivation geht von Anreizen aus, die in der Sache, der Aufgabe, dem Schwierigkeitsgrad, dem Neuigkeitsgrad und/oder den Erfolgsaussichten liegen.
Entscheidend ist jedoch, dass die intrinsische Motivation vorliegt, wenn die Tätigkeit aus Motiven gezeigt wird, die in unmittelbarer Verbindung mit der Ausführung der Tätigkeit selbst stehen.
Die extrinsische Motivation bezieht sich auf Reize von außen, z.B. Belohnung, Strafe, der Person, den Auftraggeber oder eine Aufgabe.
Wir sprechen von extrinsischer Motivation, wenn positive Konsequenzen erwartet werden, die nicht in unmittelbarer Verbindung mit der Ausführung der Tätigkeit stehen.
Wie wir es schaffen, eine Balance in unsere Motivation zu bringen?
Hin und Hergerissen zwischen inneren Motiven und äußeren Anreizen – oder die Kunst, eine innere Balance herzustellen
Der Zusammenhang zwischen Motiven und Motivation:
Motive sind in der Psychologie angeborene Dispositionen, die ihren Besitzer befähigen, bestimmte Gegenstände wahrzunehmen und durch die Wahrnehmung eine emotionale Erregung zu erleben, darauf in bestimmter Weise zu handeln oder wenigstens den Impuls zur Handlung zu verspüren.
Motivation ist die Steuerung unseres Verhaltens oder Handelns durch Motive in einer konkreten Situation mit spezifischem Aufforderungscharakter. Die Richtung, die Intensität und die Dauer unseres Handelns werden durch sie bewirkt.
Auf diese Weise wird die Aktivität einer Person auf ein ganz bestimmtes Ziel gelenkt, wobei andere Verhaltensweisen in diesem Moment ausgeschlossen werden. Ein Verhalten wird nach dieser Auffassung angeregt und durch den Aufforderungscharakter der vermutlich eintretenden Folgen des Verhaltens. Der Anreiz von außen und das Motiv stehen somit in einem Wechselwirkungsverhältnis.
Bei dem Vorgang der Motivation lassen sich zwei Pole unterscheiden:
- Der interne Pol, den wir als Personenfaktor, als Motiv = Antrieb, Bedürfnis, Strebung, Neigung, Wunsch oder Interesse bezeichnen und
- Den externen Pol, den wir als Situationsfaktor bezeichnen. Dieser Pol besitzt Aufforderungscharakter, einen Anreizwert, der die emotionale Valenz der Sache darstellt.
Wir gehen also davon aus, dass in diesem Wechselwirkungsverhältnis das Motiv eine allgemeine Aktivierung des Organismus bewirkt, während der Aufforderungscharakter der Situation die Ausrichtung dieses Strebens auf ein ganz bestimmtes Objekt bewirkt.
Wie häufig stehen wir im Leben vor Situationen in denen wir hin und hergerissen sind? Esse ich die im Café angebotene Schokoladentorte, eigentlich hatte ich mir doch vorgenommen abzunehmen. Gehe ich laufen und bewege mich oder setzte ich mich auf die Couch und schaue mir meine Lieblingssendung an. Hin und Hergerissen zwischen inneren Motiven und äußeren Anreizen.
Die größte Herausforderung eines bejahenden Lebens besteht darin, in all dem Durcheinander gegensätzlicher und widersprüchlicher innerer und äußerer Einflüsse eine Art Balance zu finden und zu wahren. Lebenskunst beschreibt Schmid (2005, 9) als die Kunst der Balance zwischen Angst und Unerschrockenheit, Beharrlichkeit und Bewegung, Lust und Schmerz, Alleinsein und Zusammensein und so vielem mehr.
Die Kunst der Balance ist weniger darauf ausgerichtet diese Polarität des Lebens aus der Welt zu schaffen, sondern sie von Grund auf anzuerkennen und mit dem Wechselspiel zwischen den Polen zu leben. Und vielleicht gelingt es uns eine innere Haltung einnehmen zu können, die „das Positive wie auch das Negative“ umfasst. Nicht das es eine Norm wäre, die Balance wahren zu müssen. Aber sich auf die Suche nach ihr zu begeben eröffnet einen Weg des Lebens, der als erfüllend erfahren werden kann. Es wird wohl auch kaum gelingen, in jedem Augenblick die Balance herzustellen und zu erfahren, sehr wohl aber durch die Zeit hindurch. Mit dem Wissen, dessen was in uns steckt. Mit dem Wissen, welche Kraftquellen wir nutzen können.
Diese differenzierte Betrachtung spielt eine besondere Rolle bei der Leistungsmotivation.Leistungshandeln ist gekennzeichnet durch einen Gütemaßstab. Die Ausführung der Tätigkeit kann gut oder weniger gut gelingen. Wir Menschen entwickeln ein individuelles Anspruchsniveau, an dem das Handlungsergebnis gemessen wird. Bei dem Erreichen oder Verfehlen des angelegten Leistungsniveaus treten Emotionen im Positiven wie Freude und/oder Stolz oder eher im negativen Sinne, wie Ärger auf.
Die intrinsische Leistungsmotivation (nach Atkinson) liegt dann vor, wenn jemand, der über ein hohes Ausmaß an Hoffnung auf Erfolg und ein eher niedriges Ausmaß an Angst vor Misserfolg verfügt. Dieser Mensch ist demnach intrinsisch hoch motiviert.
Ein Mensch, der intrinsisch niedrig motiviert ist, weil die Angst vor Misserfolg überwiegt, kann insgesamt dennoch hoch motiviert sein. Das ist dann der Fall, wenn die extrinsische Motivationskomponente (Hoffnung auf Belohnung) sehr groß ist.
Wir Menschen streben danach, Situationen und Ereignisse herbeizuführen, die positive Gefühlszustände anregen. Ebenso vermeiden wir solche Ereignisse, die uns in negative Gefühlszustände versetzen.
Wie die intrinsischen Motive und unsere Persönlichkeit ausmachen?
Mit unserer Persönlichkeit erleben wir die Welt und verhalten uns in und mit ihr
Wenn wir nun bereits einen Einblick in die Welt der Motive und der Motivation bekommen haben, sollten wir noch klären, wie diese Aspekte nun mit unserer Gesamtpersönlichkeit zusammenhängen.
Wenn wir der Frage nachgehen, aus welchen Motivationsquellen sich unsere Persönlichkeit entwickelt, wollen wir dieses Phänomen beleuchten.
In diesem Zusammenhang sprechen wir immer wieder von dem Selbst, von Persönlichkeitseigenschaften und Persönlichkeitstheorien. Bringen wir Licht in diese Begriffe indem wir zunächst beleuchten was wir unter „Persönlichkeit“ verstehen. Anschließend betrachten wir dann, wie das Ganze mit unserem Selbst zusammenhängt.
Es herrscht wahrlich kein Mangel an Äußerungen, was Begriffe wie Persönlichkeit oder Selbst zu bedeuten haben. William James äußert sich darüber wie folgt:
„Das Selbst eines Menschen ist die Summe all dessen, dass er sein eigen nennen kann, nicht nur sein Körper und seine psychischen Kräfte, sondern auch seine Kleidung und sein Haus, seine Frau und seine Kinder, seine Vorfahren und Freunde, sein Ruf und seine Werke, sein Land und seine Pferde, seine Yacht und sein Bankkonto. Wenn sie gedeihen, triumphiert er; wenn sie hinschwinden, ist er niedergeschlagen – nicht notwendigerweise bei jedem Ding im selben Maße, aber doch bei allen in sehr ähnlicher Weise.“
Die Motivstruktur eines Menschen ist so unverwechselbar wie sein Fingerabdruck.
Da insgesamt über 9 Milliarden verschiedene Motivations-Profile abgebildet werden können und keines dem anderen gleicht, wird durch die wissenschaftlich valide Motivationsanalyse das individuelle Motivprofil eines Menschen abgebildet. Demzufolge besteht unser Motivgeflecht aus einer immens großen Anzahl von Motivkombinationen die unmittelbar mit den persönlichen Werten, Einstellungen und Glaubenssätzen verbunden sind und unser Erleben und Verhalten steuern.
In aller Konsequenz hat das dann selbstverständlich Auswirkungen auch auf die Ausbildung unserer Kompetenzen und unsere Bildungsprozesse.
Um die eigenen Motive in seiner vielfältigen Ausprägung zu erfahren, ist es zunächst erforderlich diese zu ermitteln.
Unterschiede in der Motivausprägung sind verantwortlich für die Ausrichtung dessen Verhaltens sowie für die Intensität. (Langens, T., Sokolowski, K., Schmalt, H.-D., in Erpenbeck, J./ von Rosenstiel, S.75 ff.)
Wollen Sie mehr zum Thema intrinsische Motivation erfahren, dann melden Sie sich gerne bei mir, Alexander Reyss von STEP4WARD Management Beratung.